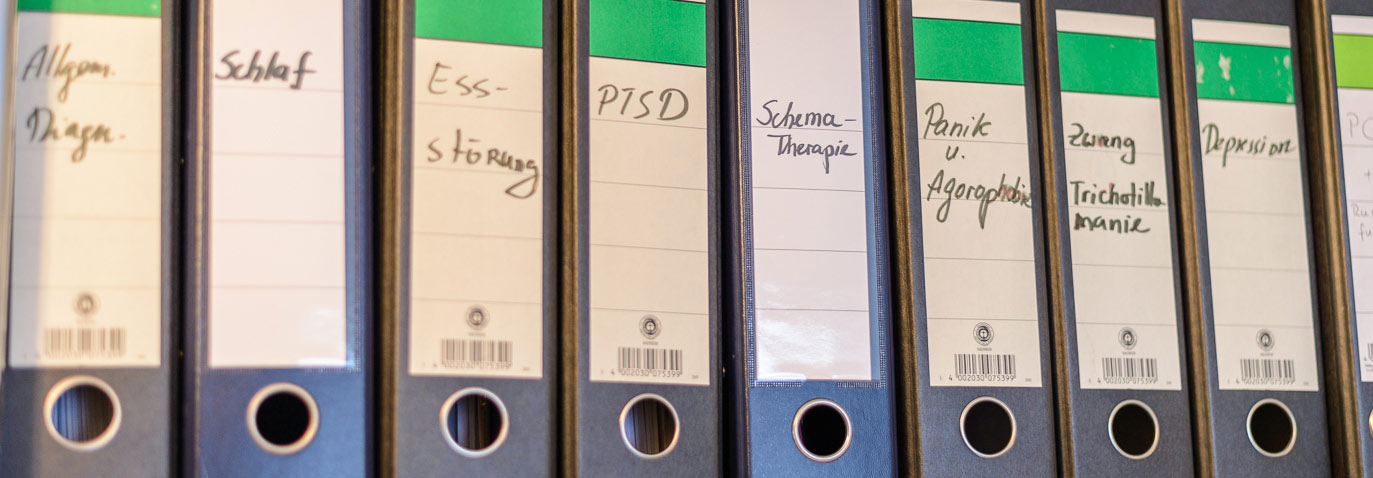
Beschwerdebilder – Fallbeispiele, Literaturempfehlungen und Links
- Phobische Angst
- Sozialphobie
- Panikstörung
- Agoraphobie
- Generalisierte Angststörung
- Zwangsstörungen
- Depressionen
- Akute und Posttraumatische Belastungsstörungen
- Somatoforme Störungen
- Essstörungen
- Körperdysmorphe Störung
- Suchtprobleme
- Pathologisches Spielen
- Sexuelle Funktionsstörungen
- Aufmerksamkeitsdefizit - Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- Borderline Persönlichkeitsstörung
Phobische Angst
Spezifische Phobien sind äußert intensive und immer wieder auftretende Furchtreaktionen, die durch spezifische Situationen oder Objekte ausgelöst werden und von dem zwingenden Wunsch begleitet sind, diese Situationen oder Objekte zu vermeiden. Die Intensität der Furchtreaktion erscheint einem Außenstehenden der realen Gefahr dieser Situation unangemessen und bizarr. Gewöhnlich zeigt der Phobiker Einsicht in diese Irrationalität seiner Furchtreaktion, vermag sie aber nicht willentlich unter Kontrolle zu halten (Hamm, 1997; Marks, 1987 aus A. Hamm „Spezifische Phobien“ Fortschritte der Psychotherapie)
Fallbespiel:
Der weitere Karriereschritt für Frau Z. ist zum Greifen nah. Dafür müsste sie aber nach Australien, worüber sie sich sehr freuen würde, wäre da nicht die Angst, den Spinnen der Region zu begegnen. Schon die einheimischen Spinnen rufen bei Frau Z. panische Angst hervor und lassen sie schneller atmen, zittern und aufschreien. Sie möchte gern mehr Kontrolle über ihre Furchtreaktion haben, um sich ihren Traum erfüllen zu können.
Literaturempfehlungen:
- Dombrowski, H.-U. (2001). Angst erfolgreich überwinden. München: CIP-Medien VerlaG
- Mathews, A., Gelder, M., Johnston, D. (1994): Platzangst. Basel: Karger Verlag
- Wittchen, H.-U. (1997): Wenn Angst krank macht. Störungen erkennen, verstehen und behandeln. München: Mosaik
- Schröder, B. (2000): Der Weg durch die Angst. Reinbek: rororo
- Wolf, D. (2016): Ängste verstehen und überwinden. Mannheim: PAL-Verlag
Die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Lebens eine Spezifische Phobie zu entwickeln liegt nach Umfragen in Deutschland bei 8 %. (Wittchen, 1986)
Sozialphobie
Zentrales Merkmal von Sozialphobie ist die Überzeugung oder Erwartung, dass das eigene Verhalten oder körperliche Symptome (z. B. rot werden, zittern, stottern) von anderen Menschen als peinlich bewertet wird. Diese Überzeugung oder Erwartung drückt sich vor allem in Gefühlen von Angst und Scham, körperlicher Anspannung und einer starken Vermeidung von Situationen aus, in denen eine Konfrontation mit dieser negativen Bewertung möglich ist. Die Ängste können sowohl in Situationen ausgelöst werden, in denen eigene Handlungen vor anderen ausgeführt, von diesen beobachtet und bewertet werden könnten (so genannte Leistungssituationen), als auch in Interaktionssituationen (z.B. Unterhaltungen), in denen das eigene Verhalten und die Reaktionen anderer in wechselseitiger Beziehung stehen.
Fallbeispiel
Eine 23-Jährige Klientin sucht einen Psychotherapeuten auf, weil sie Angst hat, auf Partys zu gehen. Sie fühlt sich auf Partys immer unwohl und angespannt. Schon die Vorbereitung ist für sie sehr schwierig, weil sie unsicher ist, was sie anziehen soll. Sie befürchtet, dass sie ausgelacht wird, weil sie das Falsche angezogen hat. Außerdem geht sie davon aus, dass sie rot wird, wenn man sie anspricht, und das ist ihr sehr peinlich. Die anderen könnten sie für unsicher oder dumm halten, und genau das will sie auf jeden Fall vermeiden. Derzeit sagt sie fast alle Einladungen ab, so dass sie schon deutlich weniger eingeladen wird und die wenigen Freunde sie über ihre gehäuften Ausreden belächeln. Sie zieht sich immer mehr zurück und fühlt sich einsam und unglücklich.
Literaturempfehlungen
Lydia Fehm/Hans-Ulrich Wittchen (2004): Wenn Schüchternheit krank macht. Ein Selbsthilfeprogramm zur Bewältigung Sozialer Phobie. Göttingen: Hogrefe.
Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens eine soziale Phobie zu entwickeln, liegt bei 13,3 % und stellt damit in den USA nach Depression und Alkoholismus die dritthäufigste psychische Störung dar.
Panikstörung
Das wesentliche Kennzeichen der Panikstörung sind wiederkehrende schwere Angstattacken (Panik), die sich nicht auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beschränken und deshalb auch nicht vorhersehbar sind. Wie bei anderen Angsterkrankungen variieren die Symptome von Person zu Person, typisch ist aber der plötzliche Beginn mit Herzklopfen, Brustschmerz, Erstickungsgefühlen, Schwindel und Entfremdungsgefühlen gegenüber anderen Menschen. Fast immer entsteht dann auch die Furcht zu sterben bzw. vor Kontrollverlust oder Angst, wahnsinnig zu werden.
Fallbeispiel
Frau K. ist eine 43-Jährige Bürokauffrau und sucht auf Anraten ihres Hausarztes die Psychotherapiepraxis auf. Sie hat mehrere körperliche Symptome wie Druck- und Engegefühl in der Brust, Schwindel und Herzrasen, Schweißausbrüche, Atemnot und Benommenheit, für die keine Ursache gefunden wurde. Diese Symptome kommen plötzlich, so dass Frau K. Angst zu sterben hat, und deswegen mehrmals schon den Krankenwagen gerufen hat.
Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens eine Panikstörung zu entwickeln, liegt nach Studien bei 2,4%.
Agoraphobie
Unter Agoraphobie versteht man ein umgrenztes bis generalisiertes Vermeidungsverhalten, das sich entweder auf bestimmte Situationen oder Orte bezieht, z.B. den Supermarkt, oder auf alle möglichen Situationen und Orte bezogen ist, die sich dadurch auszeichnen, dass eine Flucht bei einem Panikanfall schwierig oder peinlich wäre. Das Entfernen von sicheren Orten (meist zu Hause) wird als bedrohlich erlebt. Agoraphobische Situationen werden in Begleitung oder mit Sicherheitssignalen (Medikamente, Riechsubstanzen, Telefonnummer der Behandlungsperson) leichter ertragen.
Fallbeispiel
Eine 28-Jährige Frau berichtet, dass sie nur selten das Haus verlässt. Sie vermeidet Menschenmengen oder auch öffentliche Plätze. Außerdem fährt sie nie alleine Bus oder Zug. Wenn sie gezwungen ist, alleine aus dem Haus zu gehen, führt sie immer ein Handy mit der Nummer des Hausarztes mit, Lutschbonbons und ein Asthmaspray. Sie leidet sehr unter ihrer Angst, da sie sich immer mehr von ihren Freunden zurückzieht und den Anschluss verpasst.
Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens eine Agoraphobie zu entwickeln, liegt nach Studien bei 5,7%..
Generalisierte Angststörung
Die Hauptmerkmale der Generalisierten Angststörung sind sehr starke, allgemeine und vielfältige Sorgen, Befürchtungen oder Ängste, die zu einer deutlichen Beeinträchtigung des Lebens der betroffenen Personen führen. Die lang andauernden Sorgen, Befürchtungen und Ängste sind nicht auf bestimmte Situationen beschränkt, wie z.B. bei den phobischen Störungen. Von den Betroffenen werden die Sorgen als schwer kontrollierbar erlebt. Neben diesem Phänomen der Sorgen finden sich bei Betroffenen häufig Symptome wie Schlafstörungen, Muskelverspannungen, leichte Ermüdbarkeit, Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit, aber auch körperliche Symptome wie Schwitzen, Herzrasen, Magenbeschwerden, Übelkeit, Erstickungsgefühle und Schwindel.
Fallbeispiel
Eine 40-Jährige Mutter zweier Kinder kommt in die psychotherapeutische Praxis, weil sie sich nicht entspannen kann, häufig müde und gereizt ist. Sie hat Magenprobleme und leidet unter Schwindel. Ihre Familie meint, dass sie sich sehr schnell Sorgen mache, was die Familienmitglieder nicht nachvollziehen können. Sie macht sich Sorgen darüber, dass ihr Ehemann auf dem Weg zur Arbeit einen Unfall haben könnte, dass sie ohne Geld dastehen werden, dass sie selbst oder jemand aus der Familie eine schlimme Krankheit bekommen könnte. Diese Sorgen sind sehr quälend und legen sich erst, wenn sie ihren Ehemann während seiner Fahrt zur Arbeit mehrmals anruft. Auch die Kinder müssen ihr immer wieder sagen, wo sie gerade sind. Der Ehemann muss ihr wiederholt bestätigen, dass sein Job sicher ist und sie sich keine Sorgen über die möglichen finanziellen Schwierigkeiten machen soll. Diese Beruhigungen helfen zunächst, die Sorgen kommen aber immer wieder.
Nach wissenschaftlichen Studien ist die Generalisierte Angststörung eine der häufigsten Angststörungen. Etwa zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen.
Zwangsstörungen
Die Betroffenen bei einer Zwangsstörung verspüren einen subjektiven Drang, bestimmte Dinge zu denken oder zu tun, um eine vermeintliche Gefahr abzuwenden, was quälend und zeitaufwändig ist. Sie versuchen deshalb, diese Gedanken abzuwehren bzw. den Handlungsimpulsen zu widerstehen. Es gelingt ihnen aber nicht, sie zu unterlassen. Sie erleben diesen Drang als etwas, was von ihnen selbst kommt, und können die Übertriebenheit der Handlungen einsehen.
Fallbeispiel
Der 44-Jährige Vater von zwei Kindern berichtet über sein Verhalten vorm Schlafengehen, das er nicht unterbinden kann. Er braucht meist über zwei Stunden, bevor er ins Bett kommt, weil er vorher alle Außentüren und Fenster des Hauses kontrolliert, ob sie vor Einbrechern sicher sind. Er hat starke Angst, dass seiner Familie etwas zustoßen könnte. Trotz dieser Sorge versteht er, dass seine Kontrolle übertrieben ist. Seine selbstständigen Versuche, mit der Kontrolle aufzuhören, sind bis jetzt gescheitert, weil sein unangenehmes Gefühl ihm keine Ruhe gibt. Da ihn seine Rituale abends so viel Zeit kosten, bekommt er nicht genug Schlaf und ist morgens wie gerädert. Er leidet sehr unter der Symptomatik und wünscht sich mehr Lebensqualität.
Literaturempfehlungen
- Reinecker, H. (2006). Ratgeber Zwangsstörungen. Informationen für Betroffene und Angehörige. Göttingen: Hogrefe
- Foa, E., Wilson, R. (1994). Hör endlich auf damit – wie Sie sich von zwanghaftem Verhalten und fixen Ideen befreien. München: Heyne
- Hoffmann, N. (1990). Wenn Zwänge das Leben einengen. Mannheim: PAL Verlag
- Fricke, S. & Hand, I. (2004). Zwangsstörungen verstehen und bewältigen. Hilfe zur Selbsthilfe. Psychiatrie-Verlag
- S., Ulrike, Crombach, G., Reinecker, H. (1996). Der Weg aus der Zwangserkrankung. Vandenhoek Transparent Bd. 34. Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht
- Broschüren für Patienten und Angehörige können bei der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen
(www.zwaenge.de) bestellt werden. Die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen gibt auch Auskunft über Selbsthilfegruppen.
Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an einer Zwangsstörung zu erkranken, liegt nach Studien bei 2-3%. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt zwischen 20 und 25 Jahren. Im Allgemeinen sind Männer und Frauen etwa gleich häufig betroffen, Männer im Schnitt etwa 5 Jahre früher.
Depressionen
Eine depressive Erkrankung zeichnet sich durch Veränderungen der Stimmung, der Interessen und des Antriebs aus. Typische Symptome sind Niedergeschlagenheit, Verlust der Freude, emotionale Leere, Antriebslosigkeit, Interessenverlust und zahlreiche körperliche Beschwerden wie Schlaflosigkeit, Gewichtszunahme/-verlust, Unruhe, Verlangsamung, Müdigkeit und Energieverlust. Charakteristisch sind auch Konzentrationsprobleme, Gefühle der Wertlosigkeit und Schuldgefühle.
Viele der genannten Zustände und Beschwerden kennen jedoch alle Menschen. Sie sind, wenn sie eine bestimmte Dauer und/oder Intensität nicht überschreiten, normale, gesunde Reaktionen auf die Erfahrungen von z.B. Verlusten, Misserfolgen, Belastungen, Zeiten der Ziellosigkeit, der Einsamkeit oder der Erschöpfung.
Fallbeispiel
Frau J. ist eine 50-Jährige Frau, die sich seit Monaten niedergeschlagen und antriebslos fühlt. Sie hat keine Kraft, um etwas zu unternehmen, und findet, dass ihr nichts mehr Freude bereitet. Sie hat sich zurückgezogen und vermeidet es, sich mit Freunden zu treffen. Sie grübelt viel über die Vergangenheit, macht sich viele Vorwürfe über vergangenes Verhalten. Sie fühlt sich diesem Zustand ausgeliefert und hilflos. Sie war schon so verzweifelt, dass sie ihr Leben für sinnlos hielt und Selbsttötungsgedanken hatte.
Literaturempfehlungen
- Burns, D. (1995). Fühl Dich gut (5. Auflage); Trier: Trèves
- Hautzinger, M. (2006): Ratgeber Depression. Göttingen: Hogrefe.
- Wittchen, H.-U. et al. (1995). Hexal Ratgeber „Depression“ – Wege aus der Krankheit. Basel: Karger
- Merkle, R. (2003). Wenn das Leben zur Last wird. Ein praktischer Ratgeber zur Überwindung seelischer Tiefs und depressiver Verstimmungen. Mannheim: PAL-Verlag
- Weiterführende Informationen im Internet: www.kompetenznetz-depression.de
Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an einer Depression zu erkranken, liegt bei 5 bis 18%. Frauen haben ein doppelt so hohes Erkrankungsrisiko wie Männer.
Akute und Posttraumatische Belastungsstörungen
Die Posttraumatische Belastungsstörung ist eine Störung, die nach besonders belastenden Erlebnissen wie z.B. Unfällen, Naturkatastrophen oder dem Erleben sexueller oder nichtsexueller Gewalt auftreten kann. Die auslösenden traumatischen Ereignisse sind dadurch gekennzeichnet, dass die Person direkt eine oder mehrere Situationen erlebt, die eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit ihrer selbst oder eines anderen Menschen beinhalten. Diese Situation oder Situationen erlebt sie mit intensiver Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen. Teile der Traumatisierung erlebt die Person in der Folge auf sehr belastende Weise im Wachen oder Schlafen wieder. Auf die Erinnerungen reagiert sie zum Teil mit körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Übelkeit etc. Verbunden ist dies meist mit der Vermeidung von Situationen/Dingen, die an das Trauma erinnern, bzw. einer emotionalen Taubheit. Weiterhin treten Symptome wie Übererregung, Schlaf- oder Konzentrationsstörungen, erhöhte Schreckhaftigkeit oder Reizbarkeit auf.
Fallbeispiel
Herr S. wurde vor einem Jahr Opfer eines Banküberfalls. Er hat viel Glück gehabt und ist mit dem Leben davon gekommen, obwohl er mit der Waffe bedroht wurde. Während des Überfalls hat er sich ausgeliefert und hilflos gefühlt. Seit diesem Ereignis wacht er nachts schweißgebadet vor Angst auf. Er ist sehr schreckhaft und zuckt zusammen, wenn er Männer mit ähnlicher Statur wie die der Täter sieht. Er sieht sich nicht in der Lage, wieder am Schalter zu arbeiten, da er starke Angst empfindet. Auch zu Hause ist er schnell gereizt und fühlt sich von anderen Menschen nicht verstanden und sehr distanziert. Er macht keine Zukunftspläne mehr und leidet sehr unter seinem Zustand.
Literaturemfehlungen
- Boos, Anne (2007): Traumatische Ereignisse bewältigen: Hilfen für Verhaltenstherapeuten und ihre Patienten. Hogrefe
Die Wahrscheinlichkeit, an der Posttraumatischen Belastungsstörung im Laufe des Lebens zu erkranken, liegt bei ca.1 bis 9%.
Somatoforme Störungen
Das wesentliche Kernmerkmal aller somatoformen Störungen ist das Leiden unter körperlichen Beschwerden, die nicht (oder nicht ausreichend) durch einen medizinischen Krankheitsfaktor erklärt werden können. Bevor die Betroffenen einen Psychotherapeuten aufsuchen, haben sie in der Regel intensive Behandlungsversuche durch Haus- oder Fachärzte hinter sich. Patienten mit somatoformen Störungen sorgen sich oft über körperliche Vorgänge oder über mögliche Krankheiten und beschäftigen sich intensiv mit ihrem Körper und seinen Vorgängen. Üblicherweise werden körperliche Missempfindungen auf organische Schäden zurückgeführt, und es fällt den Betroffenen zumeist schwer, eine Beteiligung psychologischer Faktoren an ihren körperlichen Beschwerden anzunehmen.
Fallbeispiel
Auf den Rat des Hausarztes kommt eine 36-Jährige Frau in die Praxis, die starke Rückenschmerzen hat. Sie hatte vor Jahren einen Bandscheibenvorfall und wurde operiert. Mittlerweile sind drei Jahre vergangen, ohne dass die Schmerzen nachgelassen haben. Die Ärzte können die anhaltenden Schmerzen nicht mehr erklären. Frau Z. fühlt sich durch die Schmerzen stark eingeschränkt. Sie unternimmt kaum etwas mit Freunden, weil die Schmerzen stark sind. Sie möchte ihre Freunde nicht zwingen, nur etwas zu machen, wo sie auch mitmachen kann. Dieser Zustand macht sie traurig, hilflos und wütend. Sie schämt sich dafür, dass sie nicht voll funktionsfähig ist und möchte keinem zur Last fallen. Frau. Z. fand es komisch, dass sie zum Psychotherapeuten geschickt wurde und ist skeptisch, ob sie hier richtig ist. Sie ist aber so verzweifelt, dass sie mit Hilfe der Psychotherapie lernen möchte, mit den Schmerzen umzugehen.
Literaturemfehlungen
- Sachse, U.: Schwarz ärgern, aber richtig. Klett-Cotta
- Rauh & Rief (2006): Ratgeber Somatoforme Beschwerden und Krankheitsängste. Göttingen: Hogrefe
In westlichen Zivilisationen liegt die Wahrscheinlichkeit, an somatoformen Störungen im Laufe des Lebens zu erkranken, bei 10 bis 15%. In Allgemeinarztpraxen muss mit einem Anteil von 20 bis 30% somatoformer Störungen gerechnet werden, aber auch bei Fachärzten werden die betroffenen Patienten häufig vorstellig, um eine spezielle medizinische Diagnostik durchführen zu lassen. Studien haben ferner gezeigt, dass in medizinischen Allgemein- und Fachkrankenhäusern bis zu etwa einem Drittel der Patienten an behandlungsbedürftigen somatoformen Beschwerden leidet. Es kommt nicht selten vor, dass die somatoforme Symptomatik nicht erkannt und daher auch nicht adäquat erkannt wird.
Essstörungen
Unter dem Begriff Essstörungen sind zwei Varianten definiert: Anorexie und Bulimie. Das zentrale Symptom dieser Problematik wird in den krankhaften Veränderungen des Essverhaltens gesehen, welches sich einerseits in auffälligem Umgang mit Nahrung zeigt: bei der Anorexie beispielsweise in Form von Verweigerung ausreichender Nahrungsaufnahme oder bei bulimischen Patienten in Form von Heißhungerattacken. Anderseits gehen Essstörungen mit einer übermäßigen Beschäftigung mit den Themen Figur, Nahrung und Gewicht einher. Ebenso charakteristisch für Essstörungen sind Störungen des Körperbildes sowie Selbstwertprobleme in Form von Schamgefühlen.
Fallbeispiel
Eine 23-Jährige Studentin berichtet über ihre Unzufriedenheit mit dem Gewicht. Sie wiegt bei einer Körpergröße von 1.76m 70kg. Sie hat schon mehrere Diäten ausprobiert, die langfristig keine Gewichtsreduktion gebracht haben. Seit drei Jahren hat sie vor allem abends Heißhungerattacken. Da sie sich nach diesen Heißhungerattacken meist schuldig fühlt und um eine Gewichtszunahme zu vermeiden, erbricht sie danach. Sie mag es nicht, mit anderen zu essen, weil sie dann ihr kontrolliertes Essverhalten nicht so leicht umsetzen kann und viele Fragen gestellt bekommt. Sie hat eine Liste an Nahrungsmitteln, die sie nicht mehr essen darf, weil sie befürchtet, davon zuzunehmen. Ihre Gedanken drehen sich meist ums Essen und ums Gewicht. Sie kann sich nur mögen, wenn sie ein bestimmtes Gewicht hat. Allerdings enden ihre Abnehmversuche meist in einer Gewichtszunahme, was sie sehr frustriert. Sie möchte in der Therapie gern wieder Kontrolle über ihr Essverhalten erlangen und lernen, sich zu mögen.
Links
www.bundesfachverbandessstörungen.de
www.bzga.de/adressen/essstoerungen.htm
Literaturempfehlungen
- Vocks, S. & Legenbauer, T. (2005). Wer schön sein will, muss leiden? Wege aus dem Schönheitswahn- ein Ratgeber. Göttingen: Hogrefe.
- Böning, V. (2000): Ausbrechen – Bulimie verstehen und überwinden. Frankfurt: Urban & Fischer.
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2000): Essstörungen. Ratgeber für Eltern, Partner, Geschwister, Angehörige, Lehrer und Betreuer.
Köln: BzgA. - Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2000): Essstörungen. Bulimie – Magersucht – Ess-Sucht. Köln: BzgA.
- Gerlinghoff, M., Backmund, H. (1995): Ess-Störungen. Anstöße zur Selbsthilfe. Stuttagart: Thieme-Verlag.
- Wise, Karen (1992): Wenn essen zum Zwang wird. Mannheim: PAL-Verlag.
- Gerlinghoff, M., Backmund, H., Mai, N. (1993): Magersucht und Bulimie. Verstehen und bewältigen. Weinheim: Beltz-Verlag.
Nach den Studien liegt die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland im Laufe des Lebens an einer Anorexie zu erkranken, bei 1,3% (Jacobi et al., 2004). Ein Großteil der Betroffenen sind Mädchen der Altersgruppe zwischen 14-19 Jahren. Gefährlich ist die Tendenz, dass Personen, die an Anorexie erkrankt sind, ein viermal höheres Risiko zu sterben haben, als Personen des gleichen Alters und Geschlechts.Die Auftretenswahrscheinlichkeit der Bulimie ist ca. 3-mal höher als die der Anorexie und liegt bei 2,4%.
Körperdysmorphe Störung
Bei der Körperdysmorphen Störung steht die übermäßige Beschäftigung mit einem Körperteil im Vordergrund, der als hässlich oder gar entstellt angesehen wird, obwohl keine oder höchstens minimale Veränderungen festzustellen sind. Lang dauernde, große Teile des Tages einnehmende ritualisierte Handlungen und/oder zwanghafte gedankliche Beschäftigung stehen im Vordergrund und führen zu starkem Leiden. Die Betroffenen sind überzeugt, dass der Mangel für andere genauso offensichtlich ist und sie deswegen abgewertet und abgelehnt werden. Dies hat oft zur Folge, dass sie ihre alltäglichen Anforderungen im sozialen, beruflichen oder anderen Bereichen nicht mehr bewältigen können. Folgeerscheinungen können Depressivität, Selbsttötungsgefährdung, Substanzmissbrauch und andere Probleme sein.
Fallbeispiel
Ein junger Mann, der gerade eine Ausbildung macht, berichtet nur unter starken Schamgefühlen, dass er soziale Kontakte möglichst vermeidet. Er kann es nicht haben, dass seine Mitmenschen ihn sehen, weil er so eine schlechte Haut hat. Jedes Mal, wenn er jemandem über seine Sorgen und Ängste erzählte, wurde er nicht verstanden, weil für andere dieser Makel an der Haut nicht sichtbar war. Trotz dieser Zusicherung ekelt sich Herr B., wenn er seine Haut anschaut. Er investiert viel Geld in Pflegeprodukte und viel Zeit in Arztbesuche. Er kann nicht mehr unbefangen feiern gehen, weil er das Gefühlt hat, dass andere ihn nur anstarren, und er sich einfach mit dem Makel nicht wohl fühlt. Er merkt mittlerweile, dass sein Leben sehr eingeschränkt ist und er zunehmend ängstlich und traurig ist.
Derzeit gehen Schätzungen von einer Auftretenswahrscheinlichkeit von 1 bis 2% in der Bevölkerung aus. Aufgrund bisheriger Untersuchungen kann von einer Gleichverteilung der Störung bei Frauen und Männern ausgegangen werden.
Suchtprobleme
Kurzdefinition von Alkoholabhängigkeit
Alkoholabhängig ist entweder, wer den Konsum von Alkohol nicht beenden kann, ohne dass unangenehme Zustände körperlicher oder psychischer Art eintreten, oder wer nicht aufhören kann zu trinken, obwohl er sich oder anderen immer wieder schweren Schaden zufügt.
Vier Formen des Trinkverhaltens bei Alkoholabhängigen:
Konflikttrinken: Die Abhängigkeit besteht darin, dass der Betroffene in ganz bestimmten Situationen zu Alkohol greift, da er über keine anderen Lösungs- oder Bewältigungsmöglichkeiten verfügt.
Rauschtrinken: Die Abhängigkeit besteht darin, dass der Betroffene es trotz bester Vorsetze nicht schafft, lediglich kleinere Mengen Alkohol zu trinken. Vielmehr endet sein trinken meist in mehr oder weniger starkem Rausch.
Spiegeltrinker: Die Abhängigkeit besteht darin, dass der Betroffene über den Tag verteilt Alkohol trinkt, um die Alkoholkonzentration im Blut nie unter einen bestimmten „Spiegel“ sinken zu lassen, da sonst unangenehme Entzugserscheinungen auftreten.
Periodisches trinken: Die Abhängigkeit besteht darin, dass der Betroffene zwischen zeitweiser Abstinenz immer wieder Phasen eines unkontrollierten Alkoholkonsums hat. Dem Betroffenen sind oft keinerlei Anlass oder Auslöser hierfür bewusst, weswegen er so genanntes „magisches“ oder abergläubisches Denken zur Erklärung der Trinkphasen entwickelt.
Literaturemfehlungen
- J. Lindenmeyer (2005). Lieber Schlau als blau. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
- Feuerlein, W., Dittmar, F. & Soyka, M. (1999). Wenn Alkohol zum Problem wird: Hilfreiche Informationen für Angehörige und Betroffene. TRIAS-Verlag, Stuttgart.
Studien aus Deutschland ermittelten eine Wahrscheinlichkeit für Alkoholismus im Laufe des Lebens von 13%, bei Männern etwa viermal so hoch wie bei Frauen. Alkoholabhängigkeit stellt in den westlichen Industrienationen bei Männern die häufigste und bei Frauen nach Angststörungen die zweithäufigste psychische Erkrankung dar.
Pathologisches Spielen
Die Störung besteht in häufig wiederholtem Glücksspiel, das die Lebensführung der betroffenen Person beherrscht und zum Verfall der sozialen, beruflichen, materiellen und familiären Werte und Verpflichtungen führt. Die Betroffenen setzen ihren Beruf und ihre Anstellung aufs Spiel, machen hohe Schulden und lügen oder handeln ungesetzlich, um an Geld zu kommen oder die Bezahlung von Schulden zu umgehen. Es wird ein intensiver, kaum kontrollierbarer Spieldrang beschrieben.
Sexuelle Funktionsstörungen
Unter sexuellen Funktionsstörungen verstehen wir Störungen, die den Ablauf des vollständigen sexuellen Reaktionszyklus hemmen, verzögern, verlängern oder gänzlich unmöglich machen. Unbehandelte sexuelle Funktionsstörungen führen in den meisten Fällen zum langsamen Erliegen der Sexualität. Immer seltenere Versuche führen zu wiederkehrenden Enttäuschungen, zu einer Erhöhung der Angst und schließlich zur Chronifizierung der Symptomatik.
Folgende sexuelle Funktionsstörungen sind bekannt:
In Bereich der sexuellen Annäherung: sexuelle Aversion (Angst vor einem oder mehreren Aspekten der Sexualität, totale oder teilweise Vermeidung sexueller Situationen), Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen (selten oder nie sexuelles Verlangen, sexuelle Gleichgültigkeit), gesteigertes sexuelles Verlangen
Im Bereich der sexuellen Erregung: Versagen genitaler Reaktionen (Erregung reicht in Stärke und Dauer für den Verkehr nicht aus- fehlende Erektion oder fehlende Gleitsubstanz der Vagina „Lubrikation“)
Im Bereich des Orgasmus: Orgasmusstörung (Orgasmus selten oder nie), Ejaculatio praecox (Ejakulation vor, beim oder kurz nach dem Einführen), mangelnde sexuelle Befriedigung („physiologischer“ Orgasmus ohne Lustempfinden und orgastisches Erleben)
Im Bereich der nachorgastischen Reaktionen: nachorgastische Verstimmung (nach dem Verkehr depressive Verstimmung, Weinanfälle, Gereiztheit, innere Unruhe, Schlafstörungen)
Im Bereich der Schmerzstörung: nichtorganischer Vaginismus (Einführen des Gliedes wegen krampfartiger Verengung des Scheideneingangs gar nicht oder nur unter Schmerzen möglich- nicht organisch), nicht organische Dyspareunie (Brennen, Stechen, andere Schmerzen oder Missempfindungen im Genitalbereich)
Aus den Untersuchungen geht hervor, dass die Häufigkeit sexueller Funktionsstörungen bei Frauen bei 29% und bei Männern bei 25% liegt.
Aufmerksamkeitsdefizit – Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
Typisch für ADHS sind folgende Symptome:
Aufmerksamkeitsdefizite, Konzentrationsstörungen und Desorganisiertheit
Menschen mit ADHS erleben sich als unaufmerksam und vergesslich, sie wirken oft geistesabwesend (“mit ihren Gedanken woanders“) oder verträumt. Sie haben Schwierigkeiten, Gesprächen zu folgen und wechseln häufig das Thema. Sie haben immer wieder neue Einfälle, sind ablenkbar und könnten den Eindruck eines „chaotischen“ Gesprächsstils erwecken. Es fällt schwer, Arbeiten, Tätigkeiten und Situationen, die eine lange Aufmerksamkeitsspanne erfordern (z.B. Vorlesungen, Seminare, Sitzungen), bei unzureichender Stimulation und Motivation durchzuhalten. Gegenstände werden häufig verloren (z.B. Geldbeutel oder Schlüssel) und Termine vergessen. Arbeiten zu organisieren, zu planen und selbstständig Aktivitäten in Angriff zu nehmen, ist in der Regel mit großen Schwierigkeiten verbunden. Begonnene Aktivitäten werden oft nicht beendet und durch neu begonnene Unternehmungen unterbrochen. Bei Interesse sind viele Menschen mit ADHS anderseits in der Lage, sich extrem gut und dauerhaft zu konzentrieren (zu „hyperfokussieren“).
Impulsivität
Menschen mit ADHS handeln oft spontan (z.B. im Straßenverkehr oder beim Sport) und entscheiden „aus dem Bauch heraus (z.B. Partnerwechsel, Arbeitsplatzwechsel). Hinterher schätzen sie dieses Verhalten oft selbst als „unüberlegt“ ein.
Emotionale Instabilität
Menschen mit ADHS berichten von häufigen und raschen Stimmungsschwankungen. Diese Stimmungsschwankungen reichen von Wut und Aggressivität über Deprimiertheit zu Euphorie, oft vor dem Hintergrund allgemeiner Unzufriedenheit, Langeweile und Suche nach Stimulation.
Hyperaktivität
Die sichtbare motorische Unruhe des Kindesalters nimmt im Erwachsenenalter oft ab oder verschwindet. Bei einigen bleibt diese motorische Unruhe jedoch bestehen (z.B. Wippen mit den Füßen, Fingertrommeln oder Rutschen auf dem Stuhl). Häufig berichten Erwachsene mit ADHS von „innerer Unruhe“, sie fühlen sich chronisch angespannt, das „Gedankenkarussell“ kreist unaufhörlich. Autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder ähnliche Übungen werden als „Horror“ erlebt. Viele „brauchen“ stattdessen regelmäßig motorische Bewegung (z.B. Laufen, Rad fahren), um überhaupt im Alltag „funktionieren“ zu können und erleben Aktivitäten als „entspannend“, die andere Mensche als Extrembelastung empfinden würden.
Positive Eigenschaften und Fähigkeiten bei Erwachsenen mit ADHS
- Neugier
- Risikobereitschaft
- Energie
- Kreativität• Fantasie
- Rasche Auffassungsgabe
- Flexibilität
Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ein Krankheitsbild mit vielen Ausprägungen, ist weltweit die häufigste kinder- und jugendpsychiatrische Erkrankung. Sie „wächst“ sich – nach Ansicht der Wissenschaft- nicht aus. Vielmehr begleitet sie die Betroffenen in unterschiedlicher Ausprägung oft ein Leben lang. Wir rechnen heute damit, dass 4 bis 5% der Kinder und etwa 1 bis 2% der Erwachsenen betroffen sind.
Borderline Persönlichkeitsstörung
Typisch für die BPS ist ein tiefgreifendes Muster von Instabilität. So versuchen die Betroffenen ein tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu verhindern. Es führt dazu, dass die Beziehungen entweder nicht lange halten oder sie erleben schnellen Wechsel von dem intensivsten Glücksgefühl bis zur tiefsten Enttäuschung. Auch in dem Gefühlsleben ist ein ständiger Wechsel von Traurigkeit, Angst, Ärger oder Gefühl von Leere. Die meisten Betroffenen haben Probleme mit ihren Gefühlen umzugehen. Sie empfinden sie besonders intensiv, so dass sie für Betroffenen unaufhaltbar scheinen. In diesem Notzustand können selbstverletzendes Verhalten, riskantes Handeln und Selbstmordabsichten auftreten. Auch die starke Impulsivität ist charakteristisch für die Patienten, so kann es zu den plötzlichen Wutausbrüchen führen.
Fallbeispiel
Fr. S. ist niedergeschlagen, wiederholt ist ihre Beziehung mit Krach beendet worden. Sie verstehe nicht, wie es wieder dazu kommen konnte. Sie sei es gewohnt gewesen, alles für ihren Partner zu machen und habe sich bemüht, ihm seine Wünsche unausgesprochen zu erfüllen. Auch wenn ihr Partner ihr die Liebe immer wieder versichert habe, traute sie ihm nicht. Sie kontrollierte sein Handy nach möglichen SMS`s von anderen Frauen und durchsuchte immer wieder seine Kleidung, nach eventuellen Spuren der Untreue. Sobald der Partner es mitbekommen habe, gab es Streit. Der Freund sei sauer gewesen und Fr. S. habe sich abgelehnt und verängstlich gefühlt. Sie sei außerdem meist auch wütend geworden und sei dann unfair gewesen, weil sie sich so angegriffen gefühlt habe. Als dann die Schuldgefühle noch dazu kamen, fühlte sie sich nicht mehr in der Lage ihre Gefühle auszuhalten, sie sei dann im Bad verschwunden und habe sich selbst verletzt.
Links
http://www.borderline-community.de/
http://www.borderline-netzwerk.de/
http://www.borderline-netzwerk.info/
Literaturemfehlungen
- Knuf, A. & Tilly, C. (2007): Borderline- Das Selbsthilfebuch. Balance-Buch + Medien.
- Sender, Ingrid (2000): Borderline. Ein Ratgeber für Betroffene und Angehörige. CIp-Medien.
Die Auftretenswahrscheinlichkeit in der Allgemeinbevölkerung liegt bei 1,2 %. Dabei sind davon 60% Frauen und 40% Männer. (Torgerson, 2001)
